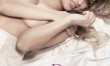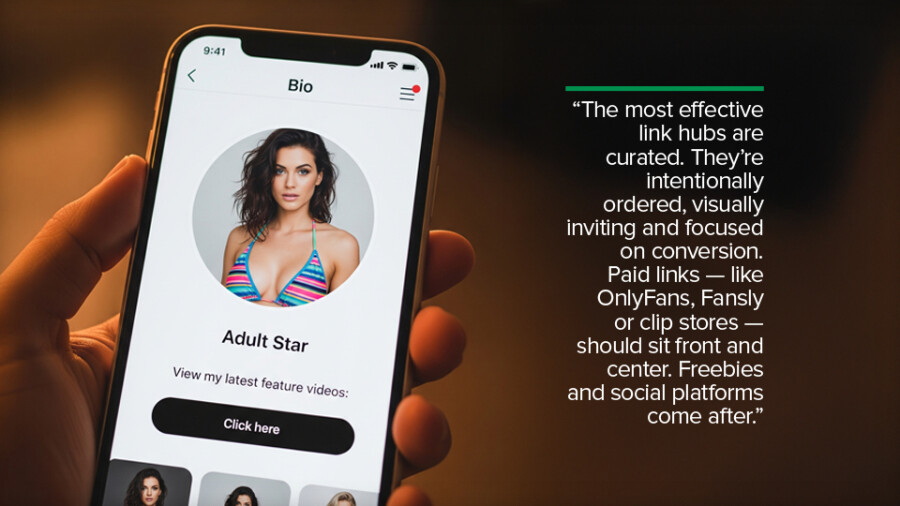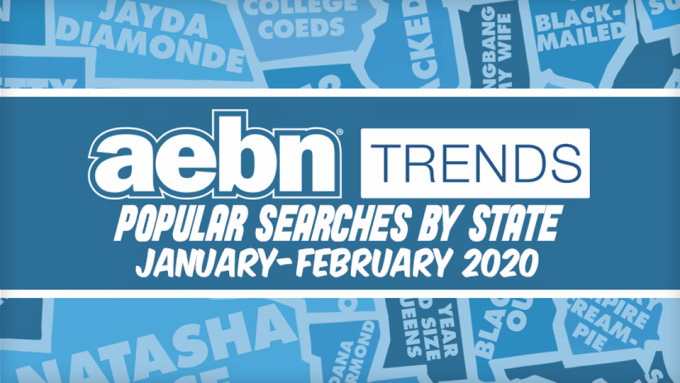Sexarbeit ist ein Thema, das in Deutschland seit vielen Jahren intensiv diskutiert wird.
Mit dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), das am 1. Juli 2017 in Kraft trat, wollte der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen modernisieren, Menschenhandel bekämpfen und die Situation von Sexarbeitenden verbessern. Doch was hat sich seitdem wirklich verändert?
Die wichtigsten Neuerungen des Gesetzes
- Anmeldepflicht für Sexarbeitende
Jeder Mensch, der in Deutschland Sexarbeit anbietet, muss sich offiziell bei den zuständigen Behörden anmelden. Dabei gibt es ein verpflichtendes Informationsgespräch und eine Gesundheitsberatung. - Regelungen für Prostitutionsstätten
Betreiber*innen von Bordellen, Escort-Agenturen oder ähnlichen Einrichtungen brauchen seitdem eine behördliche Erlaubnis. Diese wird nur erteilt, wenn bestimmte Auflagen erfüllt sind (z. B. Hygienekonzepte, Schutzmaßnahmen). - Gesundheitsberatung
Sexarbeitende müssen regelmäßig an einer gesundheitlichen Beratung teilnehmen. Ziel ist es, über Infektionsschutz und Prävention zu informieren. - Kontrollen & Aufsicht
Behörden haben mehr Möglichkeiten, Prostitutionsstätten zu kontrollieren. So soll Ausbeutung und Zwangsprostitution besser verhindert werden.
Positive Effekte
- Rechtliche Klarheit: Das Gesetz hat erstmals bundesweit einheitliche Regeln geschaffen.
- Mehr Schutzangebote: In vielen Städten gibt es inzwischen Beratungsstellen, die Sexarbeitenden beim Zugang zu Gesundheitsdiensten oder rechtlicher Hilfe unterstützen.
- Aufmerksamkeit: Das Thema Sexarbeit wird stärker öffentlich diskutiert – auch über Rechte, Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz.
Kritikpunkte aus der Praxis
Doch viele Sexarbeitende sehen die Umsetzung kritisch.
- Bürokratische Hürden: Die Anmeldung ist oft kompliziert und wird als entwürdigend empfunden.
- Stigmatisierung: Viele fürchten, durch die Registrierung „aktenkundig“ zu werden, was zu Diskriminierung führen kann.
- Eingeschränkter Schutz: Wer sich nicht anmeldet (z. B. aus Angst vor Behörden), arbeitet im Verborgenen – und hat dadurch weniger Zugang zu Beratungs- oder Hilfsangeboten.
- Ungleiche Umsetzung: Je nach Bundesland und Kommune sind die Anforderungen sehr unterschiedlich.
Die Evaluation 2025 – was nun?
2025 wurde das Gesetz umfassend evaluiert. Das Ergebnis: Viele der ursprünglichen Ziele wurden nur teilweise erreicht. Zwar gibt es mehr Kontrollen und rechtliche Sicherheit, aber der erhoffte Schutz für Sexarbeitende ist oft nicht spürbar.
Organisationen wie die Deutsche Aidshilfe oder Gruppen wie die Sex Worker Action Group (SWAG) fordern deshalb Reformen:
- Abschaffung oder Lockerung der Anmeldepflicht
- Bessere gesundheitliche Versorgung ohne Zwang
- Entkriminalisierung von Sexarbeit, um echte Arbeitsrechte zu ermöglichen
- Mehr Mitbestimmung von Sexarbeitenden bei zukünftigen Gesetzesänderungen
Fazit
Das Prostituiertenschutzgesetz hat viel verändert – aber nicht unbedingt so, wie es gedacht war.
Auf dem Papier bietet es Schutz, in der Realität empfinden viele Sexarbeitende es jedoch als Kontroll- und Überwachungsgesetz.
Die aktuelle Diskussion zeigt: Ein modernes Gesetz muss Sexarbeitende stärker einbeziehen und ihre Lebensrealität ernst nehmen. Nur so kann es gelingen, Menschen wirklich zu schützen und gleichzeitig Ausbeutung effektiv zu bekämpfen.